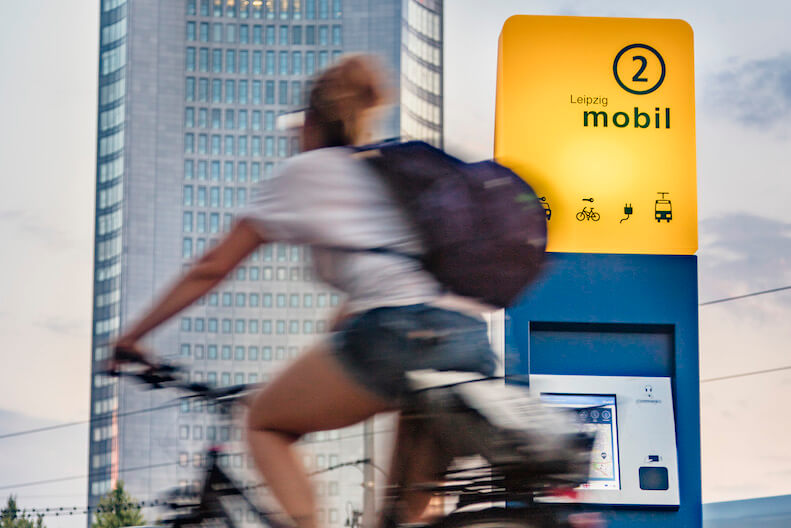Kommunale Flotte // 11.02.2021
Eine der größten Herausforderungen bei der Mobilitätswende ist der systematische und netzdienliche Aufbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Für kommunale wie private Anbieter:innen und auch Nutzer:innen von Ladeinfrastruktur stellt sich zunehmend die Frage, ob die wachsende Stromnachfrage durch Ladevorgänge den Stromnetzbetrieb beeinträchtigt. Das Hamburger Projekt ELBE zeigt, wie eine steigende Nachfrage sicher mit dem Stromnetzbetrieb in Einklang gebracht werden kann.
Intelligente Steuerung und Vernetzung von Ladeinfrastruktur
Mit einem flächendeckenden Netz von öffentlich zugänglichen Ladepunkten nimmt Hamburg eine Vorreiterrolle in Deutschland ein. Mit über 800.000 Ladevorgängen an der öffentlichen Ladeinfrastruktur wurde in 2022 ein neuer Spitzenwert erreicht. Auch die Elektrifizierung von privaten Stellplätzen nimmt weiter zu. In naher Zukunft sollen alle Ladestationen im Stadtgebiet netzdienlich und intelligent gesteuert werden.
Mit dem Modellvorhaben „Electrify Buildings for EVs“, kurz ELBE, forciert Hamburg den netzverträglichen Ausbau der Elektromobilität und die diesbezügliche Versorgungssicherheit in den Energienetzen. Verteilnetzbetreiber, Ladestationsbetreiber (Charge Point Operator, CPOs) und Forschungseinrichtungen arbeiten im Projekt zusammen, um die Wirkkette Verteilnetzbetreiber-Signal – CPO-Backend – Ladestation – Elektrofahrzeug zu überprüfen und zu optimieren. Eine neu entwickelte IT-Schnittstelle auf Basis des OpenADR-Protokolls (Open Automated Demand Response) sorgt dafür, Lastspitzen im Stromnetz, die durch ladende E-Fahrzeuge auftreten, zu reduzieren oder ganz zu vermeiden.
Über diese IT-Schnittstelle ist es dem Verteilnetzbetreiber möglich in kritischen Netzsituationen Signale zur maximalen Leistungsentnahme an den Ladestationsbetreiber zu senden, der seine Leistungsentnahme der davon betroffenen Ladepunkte daraufhin anpasst. Damit kann die allgemeine Versorgungssicherheit der Stadt auch bei wachsendem Strombedarf gewährleistet werden. Die IT-Schnittstelle wurde von insgesamt 16 CPOs bzw. deren Dienstleistern umgesetzt.
Nachfrage – Erprobung im Feldtest
Fester Bestandteil des ELBE-Projekts ist die Erprobung der Kommunikationswege zur Umsetzung einer netzdienlichen Steuerung in der Kette Verteilnetzbetreiber – CPO – Ladestation – Elektrofahrzeug. Im Rahmen eines Feldtests steuern der Verteilnetzbetreiber und die CPOs die Leistungsentnahme an allen über das Projekt geförderten Ladepunkten, um Leistungsspitzen im Verteilnetz zu reduzieren. Auch während der Reduktion ist eine 50 %-ige Ladeleistung jederzeit gegeben, sodass der Ladevorgang nicht abgebrochen wird. Das vorrangige Augenmerk liegt auf der Erfüllung des Mobilitätsbedürfnisses der Kunden und damit in einer Minimierung der Steuerungshandlungen.
Die netzdienliche Steuerung im Rahmen von „ELBE“ erfolgte ausschließlich zum Test der Kommunikationsanbindung und wurde nicht durch drohende Engpässe oder Betriebsmittelüberlastungen im Netz verursacht; d.h. für den Test wurden die Grenzwerte für eine drohende Betriebsüberlastung manuell nach unten gesetzt, um Steuerungssignale automatisch auszusenden und die Auswirkungen auf die Netzstabilität zu untersuchen.
In der Projektlaufzeit konnten von Seite des Verteilnetzbetreibers Stromnetz Hamburg über 500 Ladepunkte von acht verschiedenen Ladepunktbetreibern über die IT-Schnittstelle netzdienlich gesteuert werden.
Lokale Speicherlösungen für mehr Netzstabilität
In einem weiteren Projektteil wird erforscht wie Stromspeicher, Ladeinfrastruktur und dezentrale Energieerzeugungsanlagen als ein zusammenhängendes System intelligent eingesetzt werden können, um die Unabhängigkeit von Stromanbietern zu steigern und gleichzeitig die Kosten für den Stromverbrauch zu reduzieren.
Künftig kommt der bedarfsgerechten Steuerung auftretender Schwankungen im Stromnetz eine größere Bedeutung zu. Sowohl der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien als auch die infrastrukturelle Verzahnung bislang unabhängiger Teilsysteme wie Verkehr, Energiewirtschaft und Industrie wirken sich auf die Netzstabilität aus.
Sicheres Laden via SMGW
Im Januar 2020 wurde das Projekt ELBE um die pilothafte Einbindung von Smart-Meter-Gateways (SMGW) in die Ladeinfrastruktur für Elektromobilitätsanwendungen erweitert. Ziel ist der Aufbau einer sicheren Kommunikationskette zur Steuerung einzelner Ladepunkte. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Systemarchitektur und die Rollendefinition für den Einsatzbereich Smart Mobility vorgenommen. Der Anwendungsfall wird sowohl bei Kunden im Feld erprobt als auch im Visualisierungs- und Demonstrationslabor der Helmut-Schmidt-Universität betrieben und in einer Netzsimulation skaliert. Die Untersuchung lieferte Erkenntnisse zum sicheren Lademanagement und zur datenschutzkonformen Abrechnung.
Ein Smart Meter Gateway (SMGW) ist die zentrale Kommunikationseinheit eines intelligenten Messsystems. Im SMGW laufen Verbrauchsdaten der vernetzten Stromzähler zusammen, werden gespeichert und weitergeleitet. In eine elektrische Anlage eingebunden, kann es bspw. im sogenannten Heimnetz mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (z.B. Wärmepumpe zur Gebäudeheizung, Wallbox etc.) bzw. mit Energieerzeugungsanlagen (z.B. PV-Anlage) kommunizieren.
Das SMGW ist in der Lage, auch mit Dritten, zum Beispiel dem Verteilnetzbetreiber zu kommunizieren. So können Steuerungssignale im Bedarfsfall übertragen werden und steuerbare Verbraucher in ihrer Leistungsaufnahme reduziert oder erhöht werden, um das Stromnetz stabil zu halten.
Großskalierter Modellversuch in Wohn- und Gewerbeimmobilie
Das Thema netzdienliches Laden wurde in ELBE nicht nur erforscht, sondern auch gefördert. Über das Projekt förderte der Bund die Ausstattung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Firmenarealen mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. Die Förderung war zweckgebunden und stand juristischen Personen, Personengruppen und Unternehmen am Standort Hamburg zur Verfügung.
Voraussetzung für die geförderte Errichtung der Ladepunkte war die Steuerung des Lastmanagements über einen teilnehmenden CPO, welcher die IT-Schnittstelle zum Verteilnetzbetreiber Stromnetz Hamburg umgesetzt hat. Im Projekt wurden über 1.400 Ladepunkte aufgebaut. Dabei haben unterschiedliche Branchen über ELBE Ladepunkte in Hamburg errichtet, darunter die Immobilienwirtschaft, Flottenbetreiber, Unternehmen für ihre Mitarbeiter und Kunden sowie die Verwaltung und Vereine wie auch Wohnungseigentümergemeinschaften. Das Projekt lief vom Oktober 2018 bis Dezember 2023.

Foto: Oliver Vonberg
Key facts
Partner
Behörde für Wirtschaft und Innovation
Hamburg Stromnetz Hamburg GmbH
ChargePoint Germany GmbH
Energy Project Solutions GmbH
Hamburger Energiewerke GmbH
TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH
hySOLUTIONS GmbH
Hamburgische Investitions- und Förderbank AöR
Kontakt
hySOLUTIONS GmbH
Galya Vladova
Mail: galya.vladova@hysolutions-hamburg.de
Web: www.hysolutions.de/hamburg-laedt-netzdienlich
Tel.: +49 40 3288 4436
Fotos: Torsten Stapel